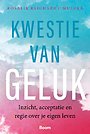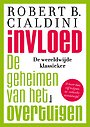E: Individualentscheidung Bei Risiko: Erweiterung und Vertiefung.- XIV. Bernoulli-Prinzip und zustandsabhängige Nutzenfunktionen.- 1.Problemstellung.- 2.Grundidee und Bedeutung des Konzepts zustandsabhängiger Nutzenfunktionen.- 2.1.Zustandsabhängige Geldverwendungsmöglichkeiten und zustandsabhängige Nutzenfunktionen.- 2.2.Die allgemeine Bedeutung zustandsabhängiger Nutzenfunktionen.- 3.Beispiele.- 3.1.Beispiel XIV.1.- 3.1.1.Die Problematik des Kriteriums (XIV.3).- 3.1.2.Modifikation des Kriteriums (XIV.3) durch Berücksichtigung zustandsabhängiger Nutzenfunktionen.- 3.1.3.Zum Problem der Bestimmung zustandsabhängiger Nutzenfunktionen.- 3.2.Beispiel XIV.2.- 3.2.1.Die Problematik des Kriteriums (VIV.3).- 3.2.2.Modifikation des Kriteriums (XIV.3) durch Berücksichtigung zustandsabhängiger Nutzenfunktionen.- 4.Allgemeine Darstellung.- 4.1.Modifikation des Kriteriums (XIV.3).- 4.2.Zur Bestimmung zustandsabhängiger Nutzenfunktionen.- 4.2.1.Die Bestimmung der Nutzenwerte der Ergebnisse Gas,Ss.- 4.2.2.Die zustandsabhängigen Nutzenfunktionen.- 4.3.Nochmals: Beispiel XIV.2.- 5.Identische Nutzenfunktionen für verschiedene Umweltzustände.- XV. Zur Messung subjektiver Wahrscheinlichkeiten bei zustandsabhängigen Nutzenfunktionen.- 1. Problemstellung.- 2.Die äquivalente Urne.- 2.1.Darstellung des Konzepts.- 2.2.Die Problematik des Konzepts bei zustandsabhängigen Nutzenfunktionen.- 2.3.Grenzen einer Modifikation des Konzepts.- 3.Bewertung von Wetten.- 3.1.Darstellung des Konzepts.- 3.2.Die Problematik des Konzepts bei zustandsabhängigen Nutzenfunktionen.- 4.Fixierung von Indifferenzgewinnen.- 4.1.Grundidee und Annahmen.- 4.2.Bestimmung der Relationen w(Ss):w(Ss+1) und Einflußfaktoren für deren Betrag.- 4.2.1.Zustandsunabhängige Nutzenfunktionen.- 4.2.2.Zustandsabhängige Nutzenfunktionen.- 4.3.Berechnung der Wahrscheinlichkeiten w(Ss).- 5.Entscheidung bei impliziter Berücksichtigung von Wahrscheinlichkeiten: Das Transformationsprinzip II.- 5.1.Grundidee.- 5.2.Eine Zielgröße.- 5.2.1.Axiome.- 5.2.2.Entscheidung bei zwei Handlungsalternativen.- 5.2.3.Entscheidung bei mehr als zwei Handlungs-alternativen.- 5.3.Mehrere Zielgrößen.- 5.4.Vergleich mit dem Bernoulli-Prinzip.- XVI. Versicherungen und Glücksspiele im Licht des Bernoulli-Prinzips.- 1.Problemstellung.- 2.Versicherungen.- 2.1.Bedingung für die Vorteilhaftigkeit einer Versicherung.- 2.2.Risikoneutralität.- 2.3.Risikoaversion6.- 2.4.Risikofreude.- 2.5.Graphische Veranschaulichung.- 3.Glücksspiele.- 3.1.Bedingung für die Vorteilhaftigkeit eines Spiels.- 3.2.Risikoneutralität.- 3.3.Risikoaversion.- 3.4.Risikofreude.- 4.Abschließender Überblick.- XVII. Die Beschaffung von Informationen als Entscheidungsproblem.- 1.Problemstellung.- 2.Zur Informationsbewertung bei Risikoneutralität.- 2.1.Das Modell A.- 2.2.Vereinfachung des Modells A.- 3.Bestimmung eines optimalen Informationsstandes bei Nichtrisikoneutralität.- 3.1.Überblick.- 3.2.Das Grundproblem der Bestimmung des Informationswertes.- 3.3.Die Beurteilung von Informationen bei gegebenen Informationskosten.- 3.3.1. Die Nutzenwerte der Brutto- und Netto-Gewinne.- 3.3.2. Der Erwartungswert des Nutzens bei Beschaffung der Informationen.- 3.3.3. Bedingung für die Vorteilhaftigkeit der Informationsbeschaffung.- 3.4.Bestimmung des Informationswertes.- 3.5.Der optimale Informationsstand.- 4.Bestimmung der Wahrscheinlichkeiten w(Ii?Ss) bei mehreren Indikatoren.- 5.Mehrstufige Informationsprozesse.- 5.1.Die Problematik.- 5.2.Ein Beispiel.- 5.2.1.Annahmen.- 5.2.2.Die isolierte Beurteilung der Vorteilhaf tigkeit einer einzelnen Information.- 5.2.3.Bestimmung der optimalen Informationsstrategie.- F: Gruppenentscheidung.- XVIII. Elemente des Entscheidungsprozesses in Gruppen.- 1.Problemstellung.- 2.Die betrachtete Entscheidungssituation.- 3.Der Entscheidungsprozeß der Gruppe im Überblick.- 4.Die Determinanten der Präferenzordnung eines Gruppenmitglieds.- 5.Der Informationsprozeß in der Gruppe.- 5.1.Überblick.- 5.2.Die individuellen Präferenzordnungen zu Beginn des Informationsprozesses.- 5.3.Aktivitäten zur Beeinflussung individueller Präferenzordnungen im Informationsprozeß der Gruppe.- 5.3.1.Überblick.- 5.3.2.Beeinflussung der eigenen Präferenzordnung.- 5.3.3.Beeinflussung der Präferenzordnungen anderer Mitglieder.- 5.3.4.Das Ende des Informationsprozesses der Gruppe.- 5.4.Die individuellen Präferenzordnungen am Ende des Informationsprozesses der Gruppe.- 6.Die Abstimmung in der Gruppe.- 6.1.Formelle und informelle Abstimmung.- 6.2.Abstimmungsregeln.- 6.2.1.Beispiele für Präferenzordnungsprofile.- 6.2.2.Das Einstimmigkeits-Kriterium.- 6.2.3.Das Kriterium des paarweisen Vergleichs (Mehrheitsregel).- 6.2.4.Das Single vote-Kriterium.- 6.2.5.Das Double vote-Kriterium.- 6.2.6.Das Borda-Kriterium.- 6.3.Strategisches Verhalten bei der Abstimmung.- 6.3.1.Definitionen.- 6.3.2.Isoliertes strategisches Verhalten.- 6.3.3.Bildung von Koalitionen.- 6.4.Abstimmung über eine kollektive Präferenzordnung.- 7.Autonome und zielgebundene Gruppen.- XIX. Die Problematik eines fairen Interessenausgleichs in Gruppen.- 1.Problemstellung.- 2.Grundlagen.- 2.1.Das Präferenzordnungsprofil.- 2.2.Die kollektive Wahlfunktion als Aggregations-mechanismus.- 2.3.Kollektive Wahlfunktionen mit beschränktem und unbeschränktem Definitionsbereich.- 2.4.Ein Konzept zur Auswahl einer kollektiven Wahlfunktion.- 3.Pareto-Regeln.- 3.1.Die schwache Pareto-Regel.- 3.2.Die strenge Pareto-Regel.- 3.2.1.Darstellung.- 3.2.2.Vergleich mit der schwachen Pareto-Regel.- 3.2.3.Die strenge Pareto-Regel und das Problem der Bestimmung einer kollektiven Präferenzordnung.- 3.2.4.Die strenge Pareto-Regel als Vorauswahl-Kriterium.- 3.2.5.Exkurs: Pareto-Optimalität versus Effizienz von Alternativen.- 3.3.Die strenge erweiterte Pareto-Regel.- 4.Das Unmöglichkeitstheorem von Arrow.- 4.1.Problemstellung: Die Auswahl einer kollektiven Wahlfunktion.- 4.2.Die Anforderungen Arrows an die kollektive Wahlfunktion.- 4.2.1.Darstellung.- 4.2.2.Interpretation.- 4.3.Darstellung des Unmöglichkeitstheorems.- 5.Klassische Abstimmungsregeln im Licht des Unmöglich-keitstheorems.- 5.1.Single vote-Kriterium.- 5.2.Mehrheitsregel (Kriterium des paarweisen Vergleichs).- 5.3.Borda-Kriterium.- 5.4.Exkurs: Eine diktatorische “Abstimmungsregel”.- 6.Die Suche nach einem Ausweg aus dem Dilemma.- 6.1.Modifizierung der Anforderungen Arrows.- 6.2.Modifizierung der Problemstellung Arrows.- 7.Zur Problematik der Erfassung der Intensität individueller Präferenzen.- G: Delegation von Entscheidungen.- XX. Die Formulierung von Zielen bei Delegation von Entscheidungen.- 1.Problemstellung.- 2.Zum Zweck der Delegation.- 3.Kompatibilität und Operationalität als Anforderungen an die Zielvorgabe.- 3.1.Die Bedingung der Kompatibilität.- 3.2.Die Bedingung der Operationalität.- 4.Zielformulierung bei sicheren Erwartungen des Entscheidungsträgers.- 4.1.Eine Zielgröße.- 4.1.1.Vorgabe einer Maximierungsvorschrift.- 4.1.2.Vorgabe eines Sollwertes.- 4.2.Mehrere Zielgrößen.- 4.3.Vorauswahl durch den Entscheidungsträger und (Letzt-) Entscheidung durch die Instanz.- 4.3.1.Das allgemeine Konzept.- 4.3.2.Vorauswahl nach dem Effizienzkriterium.- 4.3.3.Vorauswahl durch Fixierung von Anspruchsniveaus.- 5. Zielformulierung bei mehrwertigen Erwartungen des Entscheidungsträgers.- 5.1.Kompatibilität der Zielvorgabe.- 5.2.Operationalität der Zielvorgabe im Widerspruch zum Zweck der Delegation.- 5.2.1.Vorgabe einer Maximierungsvorschrift.- 5.2.2.Vorgabe eines Sollwertes.- 5.3.Vorentscheidung durch den Entscheidungsträger und (Letzt-) Entscheidung durch die Instanz.- XXI. Die Delegation von Entscheidungen als Entscheidungsproblem.- 1.Problemstellung.- 2.Präzisierung des Delegationsproblems.- 2.1.Die Entscheidungssituation der Instanz.- 2.2.Delegation an einen einzelnen Entscheidungsträger.- 2.3.Delegation an eine Gruppe.- 2.3.1.Das Präferenzordnungsprofil.- 2.3.2.Abhängigkeiten und Unterschiede in den individuellen Präferenzordnungen.- 2.3.3.Die Abstimmungsregel.- 3.Entscheidung durch eine Gruppe versus Entscheidung durch einen Einzelnen.- 3.1.Isolierte Problemlösung.- 3.2.Gemeinsame Problemlösung.- 3.2.1.Einfluß der Gruppenbildung auf die Informationsmengen und Wahrscheinlichkeitsfunktionen der Mitglieder.- 3.2.2.Einfluß der Gruppenbildung auf die Ziele und Motivation der Mitglieder.- 3.2.3.Zur “ausgleichenden” Wirkung der Abstimmung21.- 3.3.Der Zeitaspekt.- XXII. Das Delegationswertkonzept.- 1.Problemstellung.- 2.Bausteine eines Modells zur Bestimmung des Wertes eines Entscheidungsgremiums.- 2.1.Die betrachtete Entscheidungssituation.- 2.2.Der Gewinnerwartungswert bei Entscheidung durch die Instanz.- 2.3.Der Wert eines Gremiums.- 2.3.1.Zustandsabhängige Alternativenwahl als notwendige Voraussetzung für einen positiven Wert.- 2.3.2.Beispiele zur Bestimmung des Wertes eines Gremiums.- 2.3.3. Ein allgemeiner Ansatz zur Bestimmung des Wertes eines Gremiums.- 3.Zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeiten p(Aa?ss ).- 3.1.Grundlagen.- 3.1.1.Annahmen.- 3.1.2.Determinanten der Entscheidung.- 3.2.Delegation der Entscheidung an einen Einzelnen.- 3.3.Delegation der Entscheidung an eine Gruppe.- 3.4.Die Notwendigkeit der Vereinfachung.- 4.Zur Höhe des Wertes eines Gremiums.- 4.1.Das Gremium wählt mit Sicherheit die vom Standpunkt der Instanz optimale Alternative.- 4.2.Das Gremium wählt nicht mit Sicherheit die vom Standpunkt der Instanz optimale Alternative.- 5.Zur Bestimmung eines optimalen Gremiums.- 6.Die Wahrscheinlichkeit P für die Wahl der günstigeren von zwei Handlungsalternativen.- 6.1.Das untersuchte Problem.- 6.2.Annahmen.- 6.3.Definition der Wahrscheinlichkeit P.- 6.4.Bestimmung von P.- 6.4.1.Stochastisch unabhängige Voten.- 6.4.2.Stochastisch abhängige Voten.- 6.5.Die Beziehung zwischen P und der Gruppengröße.- 6.5.1.Der Informations- und Abstimmungseffekt.- 6.5.2.Ein Spezialfall.- 7.Die Bestimmung einer optimalen Abstimmungsregel als Entscheidungsproblem bei Risiko.- 7.1.Die Problematik.- 7.2.Bedingungen für die Auswahl einer Abstimmungsrege1.- 7.3.Grundzüge eines theoretischen Konzepts.- 7.4.Verdeutlichung für den Zwei-Alternativen-Fall.- 7.4.1.Die Problematik des Single vote-Kriteriums.- 7.4.2.Ermittlung einer optimalen Abstimmungsregel.- Stichwortverzeichnis.